Coronavirus – FAQs
Corona: Was bayerische Bürgerinnen und Bürger wissen sollten
Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern? Wo kann ich mich bei Bedarf testen oder impfen lassen? Und wie verhalte ich mich im Falle von Symptomen oder positiver Testung? Antworten auf die wichtigsten aktuellen Fragen zu SARS-CoV-2.
Wie ist der aktuelle Stand bei Corona?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 05.05.2023 die gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite (PHEIC) aufgrund von COVID-19 aufgehoben. Infektionen mit den aktuell kursierenden Omikron-Virusvarianten von SARS-CoV-2 führen zwar meist nicht zu schweren Erkrankungen. Zudem ist die Basisimmunität in der erwachsenen Bevölkerung inzwischen hoch, womit die Gefahr durch eine Infektion für viele Menschen geringer geworden ist. Dennoch: Insbesondere bei gefährdeten Gruppen kann eine SARS-CoV-2-Infektion weiterhin schwere Krankheitsverläufe hervorrufen. Ältere sowie generell immungeschwächte Personen, oder solche Menschen, die engen Kontakt zu diesen haben, sollten daher weiterhin vorsichtig sein, um sich und andere nicht anzustecken.
Weiterführende Informationen zur Entwicklung und zur Molekularen Surveillance in Bayern und Deutschland:
Welche Corona-Regelungen gelten derzeit in Bayern oder für Reisen?
Seit dem 01.03.2023 sind alle verpflichtenden Corona-Regelungen nach bayerischem Landesrecht aufgehoben. Dazu zählt auch die Verpflichtung zum Tragen von Masken oder zur Vorlage eines Testnachweises beim Betreten von Krankenhäusern, Pflege- oder vergleichbaren Einrichtungen. Umso wichtiger ist es, sich und andere durch eigenverantwortliches Handeln zu schützen.
Einige Kliniken, Pflegeheime und Arztpraxen in Bayern schreiben das Tragen von Masken für Besucher und Beschäftigte vor. Das LGL empfiehlt, vor dem Besuch einer solchen Einrichtung Informationen über die dortige aktuelle Regelung einzuholen. Auch die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes ist zum 07.04.2023 ausgelaufen. Einreisen nach Bayern sind daher ohne coronabedingte Beschränkungen möglich. Hinsichtlich der Regelungen anderer Länder wird weiterhin empfohlen, sich vor einer Reise über örtlich geltende Bestimmungen zu informieren (siehe Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes).
Wo kann ich mich auf das Coronavirus testen lassen?
Nach Beendigung der sogenannten Bürgertests auf Grundlage der Corona-Testverordnung zum 01.03.2023 bieten nur noch vereinzelte Apotheken Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal an. Im Fall von typischen Symptomen sollte ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden, welcher bzw. welche entscheidet, ob eine (PCR-)Testung auf SARS-CoV-2 erforderlich ist. Weiterhin im Handel erhältlich sind Antigen-Selbsttests für den Alltagsgebrauch.
Wer bezahlt die Testungen auf SARS-CoV-2?
Seit 01.03.2023 besteht kein Anspruch mehr auf kostenlose COVID-19-Testungen, das heißt Tests außerhalb der Krankenbehandlungen müssen selbst bezahlt werden. (PCR-)Tests, die ein Arzt oder eine Ärztin aufgrund von COVID-19-Symptomen veranlasst hat, werden hingegen (unabhängig davon, ob bereits ein positiver Antigentest vorlag) über die Krankenkassen abgerechnet und sind für gesetzlich wie auch für privat Krankenversicherte zuzahlungsfrei.
Sind Corona-Schnelltests zuhause noch sinnvoll?
Antigen-Tests (Selbsttests und Schnelltests) haben generell nicht die gleiche Zuverlässigkeit wie PCR-Tests. Die Sensitivität variiert je nach Hersteller. Ein negatives Testergebnis schließt daher nicht unbedingt eine Infektion aus. Antigen-Tests sind jedoch hilfreich, um vor allem Personen zu identifizieren, die eine hohe Viruslast haben und damit sehr ansteckend sind. Bisher gibt es laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) keine Anhaltspunkte dafür, dass die aktuell kursierenden Omikron-Varianten durch Antigen-Tests schlechter erkannt werden, als vorherige Varianten. Wichtig für ein möglichst zuverlässiges Testergebnis ist die korrekte, der Bedienungsanleitung entsprechende Durchführung. Ist das Datum, bis zu dem ein Selbsttest sicher verwendet werden kann, abgelaufen, sollte dieser nicht mehr genutzt sondern stattdessen entsorgt werden.
Was sind die typischen Symptome einer COVID-19-Erkrankung? Wie kann ich sie von einer Grippe-Erkrankung unterscheiden?
Es ist nicht möglich, eine COVID-19- von einer Influenza-Erkrankung (Grippe) oder einer „normalen“ Erkältung nur anhand der Symptome zu unterscheiden. Typische COVID-19-Krankheitsanzeichen sind unter anderem Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen, plötzlich einsetzendes Fieber sowie Muskel- und/oder Kopfschmerzen. Daneben können Kurzatmigkeit, Atemnot, Geruchs-/Geschmacksverlust und Magen-Darm-Beschwerden sowie weitere Symptome auftreten. Bei starker Symptomatik sollte ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden.
Was soll ich tun, wenn ich für COVID-19 typische Symptome habe oder/und positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde?
Grundsätzlich sollte jeder, der Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweist, nach Möglichkeit drei bis fünf Tage oder bis zur deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause bleiben, Kontakte meiden und sich auskurieren. Dies gilt unabhängig von der Art der jeweiligen (Virus-)Erkrankung. Positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen ohne Symptome wird empfohlen, sich mindestens bis zu einem negativen Testergebnis freiwillig in Selbstisolation zu begeben.
Bei einer akuten Atemwegserkrankung, der eine COVID-19 zugrunde liegen könnte, sollten vor allem chronisch Kranke (jeden Alters), Schwangere sowie Personen im Alter über 60 oder unter zwei Jahren unabhängig vom Impfstatus eine Ärztin oder einen Arzt ansprechen. Darüber hinaus sollten sich grundsätzlich alle Personen, bei denen sich die Symptomatik nicht innerhalb weniger Tage bessert oder sogar nach Besserung wieder verschlechtert, an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) wenden, in gravierenden Notfällen an den Notruf (Tel. 112). Vor einem Arztbesuch sollte die Praxis zum Schutz anderer jedoch über die Symptome oder/und ein positives Ergebnis informiert und das weitere Handeln abgeklärt werden.
Eine generelle Pflicht zur Meldung einer SARS-CoV-2-Infektion an den Hausarzt, die Hausärztin oder das Gesundheitsamt gibt es für Bürgerinnen und Bürger nicht. Positive Ergebnisse von PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests, die durch geschultes Personal durchgeführt wurden, sind gemäß Infektionsschutzgesetz jedoch meldepflichtig. Dies gilt auch für Personen, die in Schulen oder anderen Einrichtungen diese Tests bei Dritten anwenden. Weiterführende Informationen des Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP):
Wann ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll?
Das Coronavirus verbreitet sich über Tröpfchen und Aerosole aus den Atemwegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt daher ganz generell während Erkrankungswellen das Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen, in denen sich viele Menschen aufhalten und kein Abstand eingehalten werden kann. Insbesondere Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten diese Möglichkeit zum Selbstschutz in Betracht ziehen. Positiv getestete Personen und solche mit Symptomen einer Atemwegsinfektion sollten, wenn sich der Kontakt zu anderen Personen nicht vermeiden lässt, zum Fremdschutz mindestens eine medizinische Maske, vorzugsweise eine FFP-Maske tragen. Aber: Auch Masken haben ein aufgedrucktes Verfallsdatum, nach dessen Überschreitung eine Schutzwirkung nicht mehr garantiert werden kann.
Was kann man noch vorbeugend gegen eine Infektion tun?
Nach wie vor ist neben dem Tragen einer Maske die Einhaltung der bekannten AHA+L-Regeln sinnvoll, um sich und andere vor Ansteckung zu schützen, also 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten, Hygiene beachten (wie regelmäßiges Händewaschen sowie Niesen und Husten in die Arm-Beuge) sowie wiederholtes Stoßlüften. Der wichtigste Schutz insbesondere vor schweren Verläufen einer Coronainfektion ist jedoch nach wie vor die COVID-19-Impfung. Weiterführende Informationen des Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP):
Wer sollte sich aktuell impfen lassen bzw. benötigt eine Auffrischimpfung?
Generell rät die STIKO allen Personen ab 18 Jahren (inklusive Schwangeren) weiterhin zu einer Basisimmunität, bestehend aus drei Antigenkontakten, davon mindestens einer durch COVID-19-Impfung. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO weitere Auffrischimpfungen für folgende Gruppen: a) Personen im Alter ab 60 Jahre, b) Personen (ab sechs Monaten) mit relevanten Grundkrankheiten, c) Bewohnende in Einrichtungen der Pflege, d) medizinisches oder pflegerisches Personal sowie e) Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen unter immunsuppressiver Therapie (Immunschwäche), die durch eine COVID-19-Impfung selbst nicht sicher geschützt werden können. Die jährlichen Auffrischimpfungen sollten im Herbst erfolgen. Bei Personen, für die trotz eines gesunden Immunsystems eine Auffrischimpfung empfohlen ist, aber die im laufenden Jahr bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, ist die jährliche COVID-19-Impfung in der Regel nicht notwendig. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet zur Überprüfung des Impfstatus einen virtuellen Corona-Impfcheck an.
Wo kann ich mich impfen lassen?
Die Impfung gegen SARS-CoV-2 erfolgt vornehmlich in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Auch einige Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie vereinzelte Apotheken bieten die Coronaschutz-Impfungen an. Eine vorherige telefonische Terminabsprache wird in allen Fällen empfohlen. Sofern der Arzt oder die Ärztin eine Impfung gegen Grippe (Influenza) und/oder Pneumokokken ebenfalls als sinnvoll erachtet, können diese Impfungen am selben Termin erfolgen.
Wirken die derzeitigen Impfstoffe auch gegen die aktuellen Virusvarianten?
Bei den aktuell kursierenden Varianten des Virus handelt es sich um Subvarianten von Omikron. Es stehen an Omikron angepasste COVID-19-Impfstoffe zur Verfügung, die auch von der STIKO empfohlen werden.
Wer bezahlt die Corona-Schutzimpfung?
Die Corona-Schutzimpfung ist in Bayern eine Kassenleistung, das heißt, sie kann über die Krankenkassenkarte abgerechnet werden und ist für gesetzlich Krankenversicherte zuzahlungsfrei. Für privat krankenversicherte Personen sind die jeweiligen Vertragsbedingungen des privaten Krankenversicherungsunternehmens maßgeblich.
Fachliche Informationen zu Corona
Allgemeine Fragen
Was sind Coronaviren?
Coronaviren sind behüllte RNA-Viren, die über ein breites Wirtsspektrum verfügen, zu dem Säugetiere, Vögel und Menschen gehören. Eine bestimmte Gruppe, die β-Coronaviren, können vom Tier auf den Menschen übertragen werden und beim Menschen auch schwerer verlaufende Erkrankungen auslösen.
Was ist eine „Variante“ und was ist eine „Mutation“?
Eine Mutation bedeutet die Veränderung des Genoms an einem Nukleotid / einer Basenposition. Eine Variante bedeutet eine Linie von SARS-CoV-2, die sich von anderen Linien/Varianten durch ihr Mutationsprofil unterscheidet. I.d.R. unterscheiden sich Varianten durch mehrere Mutationen an verschiedenen Stellen des Virusgenoms.
Was ist eine besorgniserregende Variante (VOC – Variant of Concern)?
Die Bezeichnung besorgniserregende Virusvariante (Variant of Concern, VOC) wird für Varianten benutzt, die im Verdacht stehen die öffentliche Gesundheit besonders stark negativ beeinflussen zu können. Solche Variants of Concerns unterliegen einer besonderen Surveillance (Überwachung).
Nur mit folgenden Merkmalen wird eine Variante von der WHO als Variant of Concern bezeichnet:
- Die Variante geht erwiesenermaßen entweder mit einem höheren Schweregrad der Krankheit, einer verminderten Wirksamkeit der Impfstoffe oder einer besonders hohen Zahl an Infizierten einher.
- Die Variante besitzt charakteristische Mutationen, die in Simulationen oder nachgewiesenermaßen Einfluss auf Übertragbarkeit, Ansteckungsrisiko, Immunantwort, Therapiemöglichkeiten oder Diagnostik haben.
- Die Variante zeigt in mehreren Regionen gegenüber anderen Varianten einen signifikanten Wachstumsvorteil oder verschlechterte möglicherweise die öffentliche Gesundheit auf andere Art und Weise.
Darüber hinaus gibt es auch die Bezeichnung VOI - variant of interest (interessante Virusvariante) für weniger besorgniserregende Viruslinien, die allerdings auch wegen bestimmter Eigenschaften unter Beobachtung stehen, weil sie sich zum Beispiel noch zur VOC entwickeln könnten.
Bisher waren dies die wichtigsten Variants of Concern, diese wurden mittlerweile deeskaliert (herabgestuft):
- Alpha: B.1.1.7 (erstes Auftreten in Großbritannien)
- Beta: B.1.351 (erstes Auftreten in Südafrika)
- Gamma: B.1.1.28.1 (erstes Auftreten in Brasilien)
- Delta: B.1.617.2 (erstes Auftreten in Indien) VOC Delta wird zur besseren phylogenetischen und epidemiologischen Nachverfolgung seit August 2021 anhand kleiner genetischer Unterschiede in Sublinien mit dem Präfix AY (z. B. AY.9) aufgeteilt. Die Sublinien werden aktuell zur Variante Delta gezählt.
- Omikron: B.1.1.529 (erstes Auftreten in Botswana und Südafrika); seit Januar 2022 die vorherrschende Variante. Omikron wurde zur besseren phylogenetischen und epidemiologischen Nachverfolgung zunächst in die Sublinien BA.1 – BA.5 unterteilt. Diese Sublinien spalten sich immer weiter auf und umfassen mit Stand Sommer 2023 über 1000 offiziell definierte Omikron Sublinien mit diversen Präfixen. Des Weiteren sind Stand Oktober 2023 ca. 800 zusätzliche rekombinante Linien mit Omikron Beteiligung definiert. Diese können ursprünglich auf die Vermischung einer Omikron und einer Delta Linie oder zweier Omikron Sublinien (wie z.B. XBB) zurückzuführen sein.
Derzeit werden keine Varianten von der World Health Organization (WHO) als Variants of Concern eingestuft (Stand: 24.10.2023).
Welche Varianten dominieren aktuell das Infektionsgeschehen?
Seit Anfang Januar 2022 setzt sich die Variante Omikron immer mehr durch und ist mittlerweile die dominierende Variante. Die Variante Omikron hat sich mittlerweile in eine Vielzahl von Rekombinanten und Sublinien aufgespaltet. Seit Anfang 2023 sinkt der Anteil der Omikron-Sublinie BA.5 zugunsten rekombinanter Linien wie XBB.*, und deren Sublinien (z. B. GK.*, EG.*), die mittlerweile den größten Anteil ausmachen. Einen Überblick zu den aktuell in Bayern zirkulierenden Sars-CoV-2-Varianten gibt das Verbundprojekt Bay-VOC. Dies ist ein bayerisches Netzwerk, in dem die Expertise der gesamten bayerischen Universitätsmedizin sowie des Öffentlichem Gesundheitsdienstes zu besorgniserregenden Virusvarianten („Variants of Concern“", VOC) gebündelt wird. Mit diesem Netzwerk konnte bereits das Auftreten der Delta-Variante im April 2021 und der Omikron-Variante im November 2021 frühzeitig und zuverlässig erkannt werden:
Wieviel Prozent der positiven Tests werden auf Varianten geprüft?
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht alle SARS-CoV-2 positiven Proben im Vorscreening mittels variantenspezifischen (vPCR) auf das Auftreten von unter Beobachtung stehender Varianten. Darüber hinaus werden am LGL aus Gründen der Surveillance von Virusvarianten ein Großteil der positiven Proben mit ausreichendem Virusgehalt einer Gesamtgenomsequenzierung unterzogen. Dabei wird das gesamte Genom der Erreger untersucht, um die entsprechende Variante zu bestimmen.
Wie lange dauert das Verfahren?
Der Nachweis einzelner Mutationen aus initial SARS-CoV -2-positiv getesteter Proben mittels variantenspezifischer PCR (vPCR) dauert je nach Labor zwischen 24 und 96 Stunden. Die Gesamtgenomsequenzierung ist ein sehr aufwendiges und kostenintensives Verfahren und benötigt je nach Labor und Probenumsatz zwischen ca. 7 und 14 Tagen (am LGL ca. 10 Tage).
Was ist eine Gesamtgenomsequenzierung?
Bei einer Gesamtgenomsequenzierung handelt es sich um eine hochauflösende Diagnostik zur Identifizierung eines Genoms, bei der die Basenabfolge im gesamten Genom ermittelt und analysiert wird.
Sind die Tests genau und zuverlässig?
Im ersten Schritt werden am LGL alle PCR-positiven Proben mittels variantenspezifischer (vPCR) auf das mögliche Vorliegen von sogenannten Varianten unter Beobachtung (VOI) vorgescreent. Das Screening gibt erste Hinweise, die dann in einer anschließenden Sequenzierung verifiziert werden können. Von Laborseite ist eine Sequenzierung methodisch nur möglich bei Proben mit relativ hoher Viruslast (Ct <30).
Wie werden die Mutationen / Varianten erfasst?
Es besteht eine Meldepflicht der Labore an die Gesundheitsämter von Typisierungsergebnissen von Erregern einschließlich von SARS-CoV-2. Diese Meldepflicht erstreckt sich auch auf alle positiven oder negativen Ergebnisse variantenspezifischer PCR-Untersuchungen (vPCR) sowie auf alle Ergebnisse der Sequenzierungen. Die Gesundheitsämter wiederum sind gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet, die von den Laboren gemeldeten Typisierungsergebnisse an das LGL und schließlich dem RKI zu melden.
Wie sind Mutationen des SARS-CoV-2-Virus gesundheitlich zu bewerten?
Mutationen im Genom des SARS-CoV-2-Virus sind von großem Interesse um das Verhalten und die Verbreitung einzelner Viruslinien gut überwachen und einschätzen zu können. Dabei lassen sich aufgrund bestimmter charakteristischer Mutationen im Virusgenom bestimmte Virusvarianten klassifizieren. Dass Viren mutieren können ist nichts Ungewöhnliches. Sie sind wie alles Leben auf unserem Planeten stets der Notwendigkeit unterworfen, sich an äußere Umwelteinflüsse anzupassen. Man sucht nach Virus-Varianten, die Veränderungen in der Übertragbarkeit, im Krankheitsbild oder der Schwere der Erkrankung bewirken, oder die auch Auswirkungen auf die gängigen Hygienemaßnahmen, auf die Diagnostik, die Therapie oder die Impfstoffe haben könnten.
Beispielhaft könnte man hier die Mutation „D614G“ im Spike Protein nennen.
Die Abkürzung D614G bezeichnet, dass diese Mutation im Spike Protein an der 614. Stelle die Aminosäure Glycin (G) anstelle der sonst üblichen Asparaginsäure (D) besitzt.
Die Mutation führte experimentell zu einer besseren Bindung des Spike Proteins an den Rezeptor der Wirtszelle und damit zu einer höheren Infektiosität. Bereits Mitte 2020 begann diese Variante das Infektionsgeschehen zu dominieren. Heutzutage gibt es quasi keine Variante mehr, die diese Mutation nicht besitzt.
Rekombinante Linien, wie z.B. XBB, entstehen hingegen durch die Kombination von Erbmaterial verschiedener SARS-CoV-2 Viren (bei XBB zwei Omikron BA.2 Sublinien). Rekombination ist ein natürlicher Vorgang in der Evolution von Viren und kann auftreten, wenn ein Patient mit zwei verschiedenen Virusvarianten infiziert ist. Die hohe Fehlerrate bei der Vermehrung von SARS-CoV-2 erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Rekombinationsereignisse, verglichen mit anderen Viren. Auch hohe Viruslasten und insbesondere lange Infektionen (z. B. häufiger bei immunsupprimierten Patienten) tragen dazu bei, dass Rekombinationen häufiger vorkommen können.
Ausführliche Hintergrundinformationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Was versteht man unter Reinfektionen an SARS-CoV-2?
Corona-Virus-Infektionen können kein einmaliges Ereignis darstellen, sondern eine Person kann sich u. U. ein mehrmals mit einem SARS-CoV-2-Virus anstecken (Reinfektion).
Welche Krankheiten lösen Coronaviren aus?
Coronaviren verursachen gemeinhin Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und der Atemwege. Manche β-Coronaviren verursachen zoonotische Infektionen, d. h. sie werden von Tieren auf Menschen übertragen und können beim Menschen auch schwer verlaufende Infektionen, meist der Atemwege, wie z. B. Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS) und Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) auslösen. Auch das neue Coronavirus SARS-CoV-2 gehört zu den β-Coronaviren. Das entsprechende Krankheitsbild wurde von der WHO als Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) benannt.
Was versteht man unter der Reproduktionszahl?
Die Reproduktionszahl R ist ein zentraler Wert zur Beurteilung des epidemischen Verlaufs. Sie gibt ein Maß an für die Übertragungswahrscheinlichkeit an, also an wie viele Personen eine mit einem Erreger infizierte Person diese Infektion in einem dafür typischen Zeitraum, dem seriellen Intervall, durchschnittlich weitergibt. Für den ursprünglichen „Wildtyp“ von SARS-CoV-2 wurde dieser Wert für eine Situation, in der das Virus sich ohne Gegenmaßnahmen in einer Bevölkerung ohne natürliche oder durch Impfung erworbene Immunität trifft , vom Robert Koch Institut (RKI) auf etwa 3 geschätzt. Neue Virusvarianten können laut RKI eine höhere Übertragbarkeit und dementsprechend eine höhere Reproduktionszahl aufweisen.
Durch verschiedene Infektionsschutzmaßnahmen kann die Übertragungswahrscheinlichkeit herabgesetzt werden. Liegt sie dauerhaft unter 1, d. h. steckt ein Infizierter weniger als eine weitere Person an, kommt die Epidemie irgendwann zum Erliegen. Die Reproduktionszahl kann jedoch wieder steigen, z. B. wenn sich das Verhalten in der Bevölkerung ändert oder sich wie oben beschrieben eine neue Virusvariante ausbreitet. Zur Beurteilung des aktuellen Infektionsgeschehens kann es daher sinnvoll sein, sie immer wieder neu zu berechnen. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt „t“ spricht man dann von R(t).
Jedoch gestaltet sich die Berechnung einer tagesaktuellen Reproduktionszahl auf Basis der von den Gesundheitsämtern erfassten Infektionsmeldungen oft schwierig, da hier aus verschiedenen Gründen mit einem Meldeverzug gerechnet werden muss, der zu einer Unterschätzung des aktuellen Werts von R(t) führen würde. Aus diesem Grund wendete das RKI bis zum Sommer 2023 das sogenannte Nowcasting-Verfahren an, das die Schätzung von R(t) für einen möglichen Meldeverzug korrigiert:
Können auch Säuglinge getestet werden?
Studienergebnisse deuten darauf hin, dass auch Neugeborene und Kinder vor Erreichen des ersten Lebensjahres an COVID-19 erkranken können, jedoch insgesamt mit eher mildem Verlauf.
Generell ist eine Testung auf SARS-CoV-2 bei Neugeborenen beziehungsweise Säuglingen möglich; ein Mindestalter für Testungen ist so gesehen nicht bekannt. Gerade für Kinder in den ersten Lebensmonaten beziehungsweise Lebensjahren bieten sich weniger belastende Verfahren zur Probenentnahme an, vor allem Abstriche aus dem Rachen.
Wie lange dauert die Inkubationszeit?
Die Zeit von der Ansteckung mit einem Erreger bis zum Beginn der Erkrankung wird als Inkubationszeit bezeichnet. Die Inkubationszeit von COVID-19 beträgt je nach Virusvariante im Mittel 3 bis 5 Tage mit einer Spannweite von 1 bis zu 14 Tagen. Die derzeit vorherrschende Virusvariante Omikron scheint im Vergleich zu anderen Varianten eine verringerte mediane Inkubationszeit von 3 Tagen zu haben.
Welche Menschen gelten als Risikopersonen bezüglich COVID-19 und welche Vorerkrankungen spielen eine Rolle?
Die Vielfalt verschiedener potenziell prädisponierender Vorerkrankungen und ihrer Schweregrade sowie die Vielzahl anderer Einflussfaktoren machen die Komplexität einer Risiko-Einschätzung deutlich. Daher ist eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe nicht möglich. Die folgenden Personengruppen haben, basierend auf der aktuellen Studienlage, nach Angaben des RKI ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf:
- ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren
- Männliches Geschlecht
- Raucher (schwache Evidenz)
- stark adipöse (übergewichtige) Personen
- Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:
- Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
- Patienten mit chronischen Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)
- Patienten mit chronischen Leberer- und Nierenerkrankungen
- Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen (z. B. Demenz)
- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
- Patienten mit einer Krebserkrankung
- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, z. B. Cortison)
- Schwere Verläufe können jedoch auch bei Personen ohne bekannte Vorerkrankungen und bei jüngeren Patienten auftreten.
Was versteht man unter Long- und Post-COVID?
Definition
Eine Infektion mit dem Coronavirus ( SARS-CoV-2) kann milde oder schwere Erkrankungsverläufe hervorrufen oder auch symptomfrei verlaufen. Meistens kommt es nach einer COVID-19-Erkrankung innerhalb weniger Wochen zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden. Vereinzelt können jedoch auch nach Abklingen der COVID-19-Erkrankung bzw. SARS-CoV-2-Infektion verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen längerfristig anhalten bzw. im Verlauf von Wochen und Monaten neu oder wiederkehrend auftreten. Nach aktuellen Leitlinien wird je nach Beschwerdezeitraum zwischen Long COVID und Post-COVID -Syndrom (PCS) differenziert: Von Long COVID spricht man ab einer Symptomdauer von vier Wochen nach Infektion, sofern die Symptome nicht anderweitig erklärt werden können. Zum Oberbegriff Long COVID gehört auch das sogenannte Post-COVID -Syndrom. Damit werden Long COVID -Beschwerden bezeichnet, die mehr als zwölf Wochen nach Infektion anhalten bzw. nach diesem Zeitraum neu auftreten und noch mindestens zwei Monate lang andauern bzw. wiederkehren.
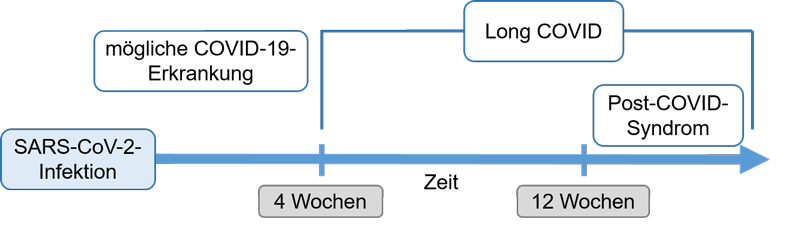
Grafik wurde auf Basis von Longcovid-info.de und dem RKI erstellt.
Symptome
Die Symptome können sehr vielfältig sein und sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit betreffen. Am häufigsten treten Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (sog. Fatigue), Kurzatmigkeit sowie Konzentrations- und Gedächtnisprobleme auf. Die Symptome können fluktuieren, sowohl einzeln als auch in Kombination auftreten oder mit der Zeit wiederkehren, was eine eindeutige Abgrenzung des Krankheitsbildes erschwert. Betroffene berichten zum Teil von deutlichen Einschränkungen im Alltag und ihrer Lebensqualität.
Prävalenz
Die bisherige Studienlage erlaubt keine verlässliche Einschätzung der Prävalenz, da u. a. keine einheitliche Definition von Long COVID verwendet wurde oder verschiedene Beschwerdebilder untersucht wurden. Grundsätzlich können alle Personen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, an Long COVID erkranken. Ein schwerer Verlauf der COVID -19-Erkrankung könnte jedoch gegenüber einem milden Verlauf oder einer asymptomatischen Infektion mit einem erhöhten Risiko für Long COVID assoziiert sein. Weiterhin scheinen Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes zu einem erhöhten Risiko beizutragen. Auch Kinder können von Long COVID betroffen sein.
Ursachen
Die Ursachen von Long COVID sind noch nicht abschließend geklärt. Diskutiert werden unter anderem eine anhaltende Entzündungsreaktion, Autoimmunprozesse sowie das langfristige Überdauern der Viren im Körper des Infizierten. Die unzureichend verstandenen Ursachen erschweren die Diagnostik und Therapie. Bislang ist daher lediglich eine symptomorientierte Therapie möglich.
Hilfe finden
Eine Übersicht möglicher Kontaktstellen im Zusammenhang mit der Behandlung von Long COVID finden Sie unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/post-covid/#post-covid_medizinische-versorgung
Forschung
Eine Übersicht der von der Bayerischen Staatsregierung finanzierten Forschungsprojekte zum Thema Long COVID /Post-COVID -Syndrom finden Sie unter: https://www.lgl.bayern.de/pcs
Quellen und weitere Informationen
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention: Post-COVID -Syndrom. Abrufbar unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/post-covid/
Bundesministerium für Gesundheit: Long-COVID-Initiative. Abrufbar unter: https://www.bmg-longcovid.de/
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Informationsportal Long COVID. Abrufbar unter: https://www.longcovid-info.de/
Robert Koch-Institut: Informationsportal des RKI zu Long COVID Abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Long-COVID/Inhalt-gesamt.html?nn=2386228
Robert Koch-Institut: SARS-CoV -2: Virologische Basisdaten sowie Virusvarianten – Spätfolgen Abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html
Ist das Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 bei Menschen mit Allergien erhöht?
Nach derzeitigen Informationsstand besteht kein erhöhtes Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 bei Menschen mit Allergien. Auch laut der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst haben Erwachsene mit einer allergischen Rhinitis, Rhinokonjunktivitis und allergischem Asthma kein erhöhtes Risiko, sich mit Corona-Viren anzustecken und haben bei Infektion mit SARS-CoV-2 mit keinem schwereren Verlauf als -„Nicht-Pollen-Allergiker“ - zu rechnen. Die gleichen Aussagen treffen für Kinder und Jugendliche zu, die eine Pollenallergie haben. (Stellungnahme der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst zum Coronavirus und Pollenflug: Coronavirus und Pollenflug – eine Information der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID): Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (pollenstiftung.de)).
Asthmatiker sollten die verordnete Therapie vor allem mit inhalativem Kortison unbedingt fortführen. Bei Patient(en)/innen, deren Asthma gut eingestellt ist, besteht keine erhöhte Infektneigung. Für Asthmatiker - Deutsche Atemwegsliga e.V.; https://www.atemwegsliga.de/service-220/information-zu-covid-19/fuer-asthmatiker.html.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei einer COVID-19-Erkrankung?
Die Therapie richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Bei leichteren Verläufen im ambulanten Setting gibt es keine evidenzbasierten Therapieoptionen. Hier muss wie bei anderen viralen Erkältungskrankheiten symptomatisch behandelt werden. Bei Zunahme von Atembeschwerden, geringer Sauerstoffsättigung im Blut und bei persistierendem Fieber sollte die mögliche Entwicklung eines schweren Verlaufs in Betracht gezogen werden. Patienten mit schwerem und kritischem Verlauf sollten frühzeitig einer intensivmedizinischen Überwachung und Versorgung zugeführt werden. Verschiedene Arzneimittel (direkt antiviral wirksame, immunmodulatorisch wirksame oder antikoagulative Substanzen) wurden und werden im Verlauf der Pandemie durch SARS-CoV-2 in Studien untersucht.
Besteht eine gesetzliche Meldepflicht?
Es besteht für den Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung, Aufnahme einer Person in ein Krankenhaus, sowie der Tod in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID -19) eine Arzt-Meldepflicht nach § 6 IfSG sowie für den direkten und indirekten Nachweis von SARS-CoV-2 eine Labor-Meldepflicht nach § 7 IfSG, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen.
Wie wird das SARS-CoV-2-Virus übertragen?
SARS-CoV-2 ist bei engem Kontakt direkt oder als Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragbar. Die Infektion erfolgt vor allem als Tröpfcheninfektion, also die Übertragung über Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen sowie beim Atmen und Sprechen entstehen und bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m leicht auf die Schleimhäute von Nase und Mund gelangen. Die Ansteckungsfähigkeit wird ab 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome angenommen, sie hält mehrere Tage an. Ein weiterer Übertragungsweg besteht durch Aerosole in der Raumluft. Beim Atmen und Sprechen, aber noch weitaus stärker beim Schreien und Singen werden vorwiegend kleine Partikel (Aerosole) ausgeschieden, beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr Tröpfchen. Während insbesondere größere respiratorische Tröpfchen schnell zu Boden sinken, können Aerosole - auch über längere Zeit - in der Luft schweben und sich in geschlossenen Räumen verteilen. Ob und wie schnell die Tröpfchen und Aerosole absinken oder in der Luft schweben bleiben, ist neben der Größe der Partikel von einer Vielzahl weiterer Faktoren, u. a. der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, abhängig.
Das Tragen einer FFP-2-Maske ohne Ausatemventil oder eines Mund-Nasen-Schutzes kann das Risiko einer Übertragung durch Partikel jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld um eine infizierte Person reduzieren.
Ein effektiver Luftaustausch kann die Aerosolkonzentration in einem Raum vermindern. Geschlossene Räume sollten daher regelmäßig und ausgiebig gelüftet werden. Übertragungen im Außenbereich kommen insgesamt selten vor.
Die Übertragung als Schmierinfektion und eine Ansteckung über die Bindehaut der Augen sind zumindest theoretisch möglich.
Besteht eine Infektionsgefahr durch SARS-CoV-2-Viren über das Trinkwasser?
Eine Übertragung des Coronavirus über die öffentliche Trinkwasserversorgung kann nach derzeitigem Kenntnisstand praktisch ausgeschlossen werden. Trinkwasser wird häufig aus Grundwasservorkommen gewonnen, die sehr gut gegen mikrobielle Verunreinigungen (einschließlich Viren) geschützt sind. Wird Oberflächenwasser oder oberflächennahes Grundwasser zur Trinkwassergewinnung genutzt, wird dieses mehrstufig aufbereitet und desinfiziert. Hierdurch werden Viren und andere Krankheitserreger effektiv und effizient eliminiert, dies gilt auch für Coronaviren.
Ein Eintrag über das Wasserwerkspersonal in das Wasserverteilungssystem ist bei Einhaltung der üblichen Hygienevorkehrungen unwahrscheinlich und wird nicht als Verbreitungsrisiko angesehen.
Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern sollte der Wasserauslass beim Trinken an öffentlich zugänglichen Entnahmestellen nicht mit Mund und Händen berührt und vor dem Trinken kurz gespült werden.
Besteht eine Infektionsgefahr beim Schwimmen oder Baden?
Das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2-Viren über das Wasser in Schwimmbädern oder Badeseen wird als gering angesehen. Möglicherweise durch Badende eingetragene Viren werden im Wasser stark verdünnt und in Schwimmbädern zusätzlich durch die Aufbereitung des Wassers entfernt.
Weitere Informationen finden Sie beim Umweltbundesamt:
Wie wird die Übertragbarkeit von SARS-CoV-2 über Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände eingeschätzt?
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen, wodurch nachfolgend Infektionen beim Menschen aufgetreten wären, gibt es derzeit keine belastbaren Belege. Allerdings sind Übertragungen durch Schmierinfektionen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, theoretisch denkbar und können nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich.
Hygieneregeln zum Umgang mit rohem Fleisch und Fleischprodukten sollten grundsätzlich eingehalten werden,
auch im Hinblick auf andere möglicherweise enthaltene Krankheitserreger. Das Virus ist hitzeempfindlich.
Ein etwaiges Risiko kann durch das Erhitzen von Lebensmitteln zusätzlich verringert werden.
LGL (2021): Merkblatt für den Einzelhandel und Direktvermarktung
Wie schütze ich mich am besten vor COVID-19?
Der wichtigste Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen einer COVID-19-Erkrankung, ist die COVID-19-Impfung.
- LGL: Impfempfehlungen gegen COVID-19
- RKI: COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die üblichen Hygieneempfehlungen beim Vorliegen von infektiösen Atemwegserkrankungen, wie z. B. Grippe schützen auch vor einer Infektion mit SARS-CoV-2. Neben dem Tragen einer Maske ist die Einhaltung der bekannten AHA+L-Regeln sinnvoll, um sich und andere vor Ansteckung zu schützen:
- mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten.
- Direkten Körperkontakt mit Erkrankten (Umarmung, Küsschen, Händeschütteln) vermeiden.
- Berührung des eigenen Gesichts mit ungewaschenen Händen vermeiden.
- Häufiges, gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife.
- Husten und Niesen in die Armbeuge.
- Wiederholtes Stoßlüften in geschlossenen Innenräumen.
Wie sind Werbebotschaften bei Nahrungsergänzungsmitteln zu bewerten, die einen Schutz vor dem Coronavirus versprechen?
Hierbei handelt es sich um unerlaubte Aussagen, mit denen die bestehenden Unsicherheiten und die Angst der Menschen ausgenutzt wird. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die eine Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln gegen eine Coronavirusinfektion belegt. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und keine Arzneimittel. Sie dienen nicht zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten und ihnen dürfen keine derartigen Eigenschaften zugeschrieben werden. Krankheitsbezogene Werbebotschaften, Heilversprechen oder Angaben, die eine Verringerung des Krankheitsrisikos suggerieren (wie z. B. „schützt vor Viren“), sind verboten.
Wie wird SARS-CoV-2 mittels PCR nachgewiesen?
Goldstandard für den Nachweis von SARS-CoV-2 ist der molekularbiologische Nachweis mittels einer speziellen PCR . Empfohlen sind Dual-Target-Systeme, d. h. in einem Testdurchgang werden zwei verschiedene Genabschnitte aus dem Virusgenom detektiert. Die Diagnostik ist am LGL und bei privaten Labordienstleistern bzw. Universitätslaboren etabliert. Die Durchführung der Diagnostik erfolgt am LGL im Auftrag des Gesundheitsamts oder im Rahmen von Surveillance-Projekten. Niedergelassene Ärzte lassen die Diagnostik bei einem Labordienstleister durchführen. Daneben kann auch ein Nachweis mittels Antigen-Schnelltest erfolgen.
Was versteht man unter einem Antigen-Schnelltest?
Bei einem Antigen-Schnelltest werden mit Hilfe spezifischer Antikörper Oberflächenstrukturen, meist Virusproteine (=Antigen) des Virus nachgewiesen. Es handelt sich also um einen direkten Virusnachweis, der in seiner Aussage mit dem PCR -Verfahren zum Nachweis von Virusnukleinsäuren gleichzusetzen ist. Antigenschnellteste weisen aber eine geringere Sensitivität als der PCR-Nachweis auf, so dass im Antigen-Schnelltest erst bei einer höheren Viruslast ein positives Ergebnis zu erwarten ist.
Gibt es eine Surveillance für virale ARE (Akute Respiratorische Erkrankungen) Erreger in Bayern?
Die virologische Surveillance des Infektionsgeschehens in Bayern basiert auf drei Säulen.
Diese bestehen aus dem Ausbau des bayerischen Verbundprojektes Bay-VOC, dem Ausbau des bayerischen Netzwerks der „Sentinel“-Praxen (BIS+C), sowie dem Ausbau des Abwassermonitorings in Bayern. Der Fokus des Bay-VOC Projekts liegt auf dem Beobachten und Erfassen besorgniserregender Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Bayern, die als „Variants of Concern (VOC)“ bezeichnet werden. Im BIS+C-Projekt senden Sentinel-Praxen (Hausarztpraxen sowie Kinder- und Jugendarztpraxen) ganzjährig einmal wöchentlich Abstriche an das LGL. Die erhaltenen Abstrichproben werden auf Influenza-, SARS-CoV-2- und RS-Viren in allen Altersgruppen untersucht. Im Rahmen des Abwassermonitorings werden zudem zweimal wöchentlich Proben aus Kläranlagen in ganz Bayern auf die Viruslast von SARS-CoV-2 untersucht. Das Zusammenspiel der drei Projekte ermöglicht einen guten Überblick über die aktuell in Bayern zirkulierenden SARS-CoV-2-, Influenza- und RS-Viren.
Warum wurde eine Meldepflicht für SARS-CoV-2-Infektionen bei Tieren eingeführt?
Untersuchungen aus verschiedenen Ländern belegen, dass sich bestimmte Tierarten ebenfalls mit SARS-CoV-2 infizieren können. Durch die Meldepflicht soll eine Übersicht über Vorkommen und Ausbreitung dieser Infektion und weitergehende Kenntnisse zur Epidemiologie gewonnen werden. Diese Informationen sollen dazu beitragen, Risiken in Bezug auf die Gesundheit von Tier und Mensch frühzeitig zu erkennen. SARS-CoV2-Infektionen sind seit Anfang Juli 2020 meldepflichtig.
Wann erfolgt die Untersuchung eines Haustieres auf SARS-CoV-2?
Eine Untersuchung kann bei epidemiologischem Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion/COVID-19-Erkrankung des Menschen sinnvoll sein. Eine solche Untersuchung kann auf Wunsch des Tierhalters erfolgen, es besteht für Haustierhalter aber keine Pflicht, ihre Tiere testen zu lassen. Falls SARS-CoV-2-infizierte Tierhalter eine Labortestung der eigenen empfänglichen Haustiere wünschen, sollte die Probennahme und die Untersuchung in Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt erfolgen. Der Tierhalter trägt die Kosten für die SARS-CoV-2-Testung. Die Probenahme sollte durch eine dafür qualifizierte und entsprechend geschützte Person vor Ort durchgeführt werden. Der Nachweis erfolgt analog zum Menschen mittels PCR. Eine Testung von Tieren ohne epidemiologischen Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion/COVID-19-Erkrankung des Menschen ist nicht sinnvoll.
Wer ist zur Meldung einer SARS-CoV-2-Infektion eines Tieres verpflichtet, was muss gemeldet werden und wann erfolgt die Meldung?
Zur Meldung verpflichtet sind Tierärzte sowie Leiter von Veterinäruntersuchungsämtern, Tiergesundheitsämtern und sonstiger öffentlicher oder privater Untersuchungsstellen. Von der Meldepflicht erfasst werden positive Befunde für alle vom Menschen gehaltenen Tiere (einschließlich Zootiere) sowie von wildlebenden Klauentieren, die in Gehegen zum Zwecke der Gewinnung von Fleisch für den menschlichen Verzehr gehalten werden. Die Meldung einer SARS-CoV-2-Infektion eines Tieres umfasst das Datum der Feststellung, die betroffene Tierart, die betroffene Tierhaltung und den betroffenen Kreis oder die kreisfreie Stadt. Der Tierarzt oder das Labor melden den Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion bei Haustieren an die zuständige Behörde (Veterinäramt), welche die Meldungen wiederum an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über das sog. Tierseuchen-Nachrichten-System (TSN) weitergibt.
Was passiert, wenn ein Haustier positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde?
In Übereinstimmung mit der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wird das Übertragungsrisiko von empfänglichen Haustieren auf den Menschen als gering angesehen. Ein infiziertes Tier sollte isoliert gehalten werden.
- FAQ SARS-CoV-2 /Covid-19 und Tiere (PDF, 320KB)
Was passiert mit meinem Haustier, wenn ich selbst an COVID-19 erkrankt bzw. mit SARS-CoV-2 infiziert bin?
Personen, die an COVID-19 erkrankt bzw. mit SARS-CoV-2 infiziert sind, sollten möglichst keinen engen Kontakt zu Haustieren haben. Haustiere, die mit einem Menschen, bei dem eine Infektion mitSARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, im selben Haushalt leben und daher wahrscheinlich dem Virus ausgesetzt waren, sollten während der häuslichen Isolierung des infizierten Menschen im Haushalt verbleiben. Wenn möglich sollte sich ein anderes, nicht infiziertes/erkranktes Haushaltsmitglied um das Tier kümmern. Unkontrollierter Freigang und Kontakt mit Menschen und Tieren aus anderen Haushalten sollten in jedem Fall unterbleiben. Dies gilt insbesondere für Katzen und Frettchen.
Es sollte möglichst vermieden werden, dass durch Abgabe der Tiere das Virus in andere Haushalte oder beispielsweise Tierheime oder Tierpensionen verbreitet wird.
Können sich Haustiere mit SARS-CoV-2 infizieren und können diese das Virus auf den Menschen übertragen?
Empfängliche Haustiere wie Hunde, Katzen, marderartige Tiere (z. B. Frettchen), Kaninchen und Goldhamster können sich mit SARS-CoV-2 anstecken. Bisher gibt es wenige wissenschaftliche Hinweise darauf, dass diese Haustiere eine Rolle im SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen spielen. Weltweit gibt es nur sehr vereinzelte Berichte zu einer Übertragung vom Tier auf den Menschen. Aus Deutschland sind solche Infektionen nicht bekannt. Dennoch gelten beim Umgang mit Haustieren ganz grundsätzliche Hygieneempfehlungen wie Händewaschen vor und nach Kontakt mit den Tieren und die Vermeidung von engem Kontakt zu den Tieren, um unabhängig von SARS-CoV-2 das Risiko einer Erregerübertragung zwischen Mensch und Haustier zu minimieren.
Weiterführende Informationen zum Umgang mit infizierten Haus- und Nutztieren finden sich auf denInternetseiten des Friedrich-Loeffler-Instituts unter FAQ: SARS-CoV-2/ Covid-19 und Tiere (openagrar.de) und www.fli.de.
Welche Maskenarten gibt es?
Folgende Arten von Gesichtsmasken werden am häufigsten zum Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion eingesetzt:
- Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
- Medizinische Gesichtsmaske / Medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS)
- FFP-Maske
Sie unterscheiden sich u. a. in ihrer Schutzwirkung hinsichtlich Eigen- und Fremdschutz. Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
An wen können Rückfragen zu Beschaffung und ggf. dem Vertrieb von PSA gerichtet werden?
Da es sich hierbei um Fragen der Marktüberwachung handelt, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Gewerbeaufsicht ihres Regierungsbezirks.
Welche Desinfektionsmittel sind gegen SARS-CoV-2 wirksam?
Zur Desinfektion können alle Mittel mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren), "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" verwendet werden. Mittel, deren Wirksamkeit für die oben genannten Wirkungsbereiche nachgewiesen sind, können der Liste der vom RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren oder der Desinfektionsmittel-Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene entnommen werden. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen ist ausschließlich die RKI-Liste heranzuziehen.

